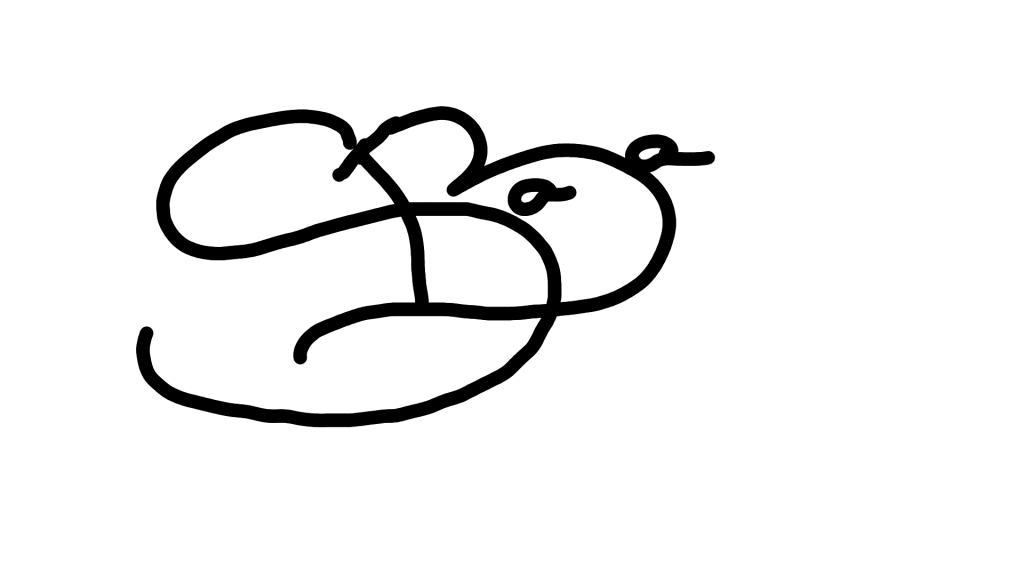von Sandra Barbosa da Silva
Kurzgeschichte
Genre: Krimi
Lesedauer: 13–15 min.

Als das Taxi in die Auffahrt zur Klinik einbog, milderte der erste Eindruck ein wenig meine gedrückte Stimmung. Der Weg war gesäumt von gepflegten Rasenflächen und das barocke Gebäude schmiegte sich an einen kleinen Wald, der zu Spaziergängen einlud. Die vierstöckige Villa wurde gesäumt von Rhododendronbüschen, und obwohl es noch früh am Morgen war, roch es bereits nach frisch gemähtem Rasen. Der sommerliche Frühnebel verlieh der Szenerie ein fast märchenhaftes Aussehen.
Hier sollte ich also die nächsten drei Wochen unter Aufsicht verbringen, um wieder in die Spur zu kommen.
Ich war erleichtert – es hätte mich schlimmer treffen können.
Die Heimleiterin war eine sehr angenehme, ältere Dame, die sich äußerlich ihrem ebenfalls barock eingerichteten Büro angepasst zu haben schien. Sie wirkte, als lebte sie hier schon jahrhundertelang. Nach einer kurzen Vorstellung der Klinik und der Verfahrensweisen durfte ich mein Zimmer beziehen.
Es lag zur Südseite hinaus, mit einem wundervollen Ausblick auf die Parklandschaft hinter dem antiken Schlösschen. Zwei Pfleger gingen dort mit einem dunkelblonden Patienten spazieren, der etwas älter wirkte als ich. Warum gleich zwei? Ich grübelte. Der Mann sah doch fit aus. Mit diesem Gedanken beschäftigt, ließ ich mich auf eines der beiden Betten plumpsen. Es hieß, ich bekäme keine Mitbewohnerin aufs Zimmer, also richtete ich mich ein wie in einem Hotelzimmer. Meine Laune stieg etwas.
Plötzlich hörte ich Radau aus dem Garten.
Durch das große Erkerfenster verfolgte ich einen Disput zwischen den drei Spaziergängern. Der dunkelblonde Mitpatient regte sich lautstark über etwas auf, brüllte einen der Pfleger an und ging schließlich mit den Fäusten auf ihn los. Darum waren sie also zu zweit. Die Pfleger steckten ihn mit drei oder vier geübten Handgriffen in eine mitgebrachte Zwangsjacke und zogen den pöbelnden, widerstrebenden Mann mit sich ins Gebäude.
Ein verstörendes Erlebnis.
Ich fragte mich, was passieren musste, damit sie einen so behandelten. Ein Klopfen an der Tür riss mich aus meinen Gedanken.
„Frau Brinkner … Melanie. Ich heiße Sylvia und bin für die nächste Zeit Ihre Therapeutin und Ansprechpartnerin. Wir duzen uns hier alle, wenn es recht ist. Das macht es etwas persönlicher. Immerhin wohnen wir hier ja alle zusammen. Ist das in Ordnung?“
„Jetzt schon? Ich bin noch gar nicht fertig eingerichtet“, entgegnete ich missmutig. Ich mag keine Überfälle, für mich muss alles organisiert der Reihe nach laufen. Sylvia lief wortlos davon und ließ die Tür weit auf. Genervt eilte ich hinterher.
Das Therapiezimmer war gemütlich eingerichtet und wirkte wie eine Wellness-Oase. Es roch dezent nach Amber und Zitronengras.
„Schöne Halskette. Wen stellt sie dar?“, eröffnete Sylvia das Gespräch.
Ich fasste an die dünne Kette mit dem kleinen Anhänger.
„Das ist der heilige Rafael. Ein Geschenk meiner Eltern.“
Sylvia nickte zustimmend. „Der Schutzpatron. Den wirst du hier nicht brauchen – wir beschützen dich.“
Sie lächelte wohlwollend, aber irgendetwas an diesem Lächeln machte mich unruhig. Ich wusste nur nicht, was.
„Erzähl doch mal, was genau führt dich zu uns? In der Überweisung steht ‚Depressiver Erschöpfungszustand‘, aber das ist ein weiter Begriff. Was quält dich?“
Zögernd begann ich zu erzählen. „Mein Vierzig-Stunden-Job. Mein nebenberufliches BWL-Studium. Mein Privatleben. Einfach alles. Ich bin erst vierundzwanzig und habe jetzt schon das Gefühl, in einer Midlife-Crisis zu stecken. Jeder reißt an mir herum, nie kann ich irgend etwas zu Ende machen und ich habe immer Angst, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Ich möchte keine Fehler machen, und so bekomme ich von überall Druck. Die Welt scheint sich immer schneller zu drehen, und ich komme einfach nicht mehr mit.“ Ich erklärte ihr, dass ich im Job als Vertriebsinnendienstlerin ständig unter Strom stünde, kaum den Anforderungen genügen könne und dass mein Privatleben wegen des nebenberuflichen Studiums bereits seit drei Jahren nicht mehr existiere. Ich schilderte ihr, wie ich unter Herzrasen, erheblichen Schlafstörungen und chronischem Händezittern litt. Dass ich mich ständig fühlte, als würde mich jemand wie eine Zitrone zusammenquetschen. Außerdem vergaß ich oft zu atmen. Sylvia blickte nachdenklich auf meine angekauten Fingernägel und nickte abschließend. Ich kam mir ausgefragt vor und war peinlich berührt, einem wildfremden Menschen sofort mein Innerstes haarklein darlegen zu müssen.
Aber Sylvia lächelte nur – damit war ich fürs Erste entlassen.
Bei der abendlichen Zimmerkontrolle legte sie mir das Therapieprogramm vor. Es sah morgendliches Schwimmen vor, Klangmassagen, Kreativkurse, regelmäßige weitere Einzelgespräche – und Gruppensitzungen. Dumpf schrillte eine Alarmglocke in meinem Kopf. Ich wollte in keiner Gruppe einen Seelenstrip hinlegen. Schon gar nicht in einer unbekannten. Aber auswählen durfte ich nichts eigenständig, und diese Erkenntnis verursachte ein unangenehmes Kribbeln in der Magengegend. Ein Blick auf den Zeitplan ließ mich schlucken. Ich war so eng getaktet und hatte so viele Berührungspunkte zu anderen Menschen, dass ich genauso gut in meinem Großraumbüro hätte bleiben können. In den darauffolgenden Tagen versuchte ich den Zeitplan irgendwie einzuhalten. Das morgendliche Schwimmen und die Klangmassagen waren der einzige Lichtblick. Die Einzelgespräche waren in Ordnung und brachten mir zum Teil etwas mehr Verständnis für meine körperlichen Symptome. Was mich allerdings völlig aus der Bahn warf waren die Gruppensitzungen, der sogenannte Stuhlkreis. Alle hatten mehr oder weniger die gleiche Diagnose – Burnout –, aber angesichts der Patientengeschichten fragte ich mich, ob ich hier tatsächlich richtig war. Offenbar gibt es bei diesem Krankheitsbild einen breit gefächerten Katalog an Symptomen. Mich machte es wahnsinnig, den Erzählungen meiner Mitpatienten über ihre seltsamen Erlebnisse lauschen zu müssen.
Manche ihrer Verhaltensweisen stießen mich ab.
Das brachte mich kein Stück weiter, ganz im Gegenteil. Müssen alle Gruppenmitglieder eine ganze Therapiestunde mit der Frage verbringen, ob Fatma nicht vielleicht einfach ihrer Kollegin den Locher hätte überlassen sollen, anstatt ihr damit auf den Kopf zu hauen? Währenddessen rutschte ich auf meinem Stuhl hin und hinter und sah ständig auf die Uhr oder aus dem Fenster.
„So, meine Lieben“, holte Sylvia mich aus meinen Träumereien zurück, „wollen wir doch unserem Neuzugang noch kurz die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Melanie, würdest du bitte aufstehen, damit alle dich sehen können? Erzähl uns doch bitte etwas über dich und warum du hier bist.“
Alles in mir sträubte sich, und ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss. So eine peinliche Situation. Das Frühstück in meinem Magen zog sich zu einem festen Klumpen zusammen. Ich fing an zu schwitzen, stotterte mir einige Sätze ab und fühlte mich nachher einfach nur noch nackt. Ein Mauseloch hätte mir über meine Scham nicht hinweghelfen können. Ich schluckte tapfer ein paar Tränen herunter.
„Das war super, Melanie. Ab morgen früh darfst du übrigens dann beim Töpferkurs mitmachen“, befand Sylvia. Verletzt verzichtete ich auf das Abendessen und versteckte mich bis zum Weckerklingeln unter meiner Bettdecke.
Am nächsten Morgen versuchte ich zwischen Schwimm-Termin und Frühstück die Therapeutin sowie die Heimleiterin davon zu überzeugen, dass ich in der Klinik nicht gut aufgehoben wäre und sofort entlassen werden müsste. Dies wurde mit der Begründung abgelehnt, dass jeder solche Startschwierigkeiten hätte und diese ein gutes Zeichen wären.
Ich war also eingesperrt.
Beim anschließenden Frühstück setzte sich Fatma zu mir – ausgerechnet die Frau, die ohne Unterlass und in einer unglaublichen Lautstärke irgendeinen verbalen Müll von sich geben musste. Sie war einfach nicht zu stoppen. Mein Gehirn schien anzuschwellen, ich konnte bei dem Geplärre nicht mehr denken. Ich wurde immer wütender angesichts dieser konstanten Respektlosigkeit. Am liebsten hätte ich sie angebrüllt, aber das war verpönt. Streitigkeiten sollten wir konstruktiv lösen, immer positiv und mit viel Verständnis für die Gegenseite. Fatma ignorierte dieses Gesetz. Begriffe wie Verhaltenskontrolle und Gehirnwäsche schossen mir durch den Kopf. Ich hielt die Luft an. So musste sich ein Tsunami fühlen – erst leise sammeln, dann laut alles unter sich begraben. Ich fragte mich, wann ich wohl völlig durchdrehen würde. Nachdenklich musterte ich Fatma und überlegte, wie sie wohl zucken würde, wenn sie auf der Stelle ersticken würde. Gezwungenermaßen, aber doch erleichtert, flüchtete ich anschließend zu meinem Töpferkurs. Auch wenn Töpfern niemals mein Hobby werden würde, so hatte das Herummatschen mit Lehm doch etwas Erdendes. Völlig in meinen Gedanken versunken, nahm ich die Mittöpfer nicht mehr wahr. Ein Moment der wohltuenden Trance. Mein Puls beruhigte sich etwas.
Plötzlich durchzuckte mich ein Blitzschlag, als Bernd – der dunkelblonde Randalierer aus dem Park – mich unvermittelt anschrie.
„Was machst du da fürn Scheiß? Kannst du dir nicht ein bisschen Mühe geben? Wenn es dir nicht passt, was wir hier machen, bleib gefälligst mit deinem platten Arsch zu Hause!“
Ich schluckte und sah auf meine Vase herunter, die eher einer geschlossenen Skulptur ähnelte. Irgendetwas knackte in meinem Kopf, und aus einem Impuls heraus warf ich ihm meine Venus von Milo mit aller Wucht ins Gesicht. Bernd taumelte rückwärts, der Lehmklumpen hinterließ dreckige Spuren auf seinem hellblauen Hemd und seiner Hose. Eigentlich überall. Sich mit der einen Hand das rechte Auge haltend, sprang Bernd mit einem Satz auf mich zu und ging mir mit der anderen Hand an die Kehle. Erschrocken japste ich nach Luft. Konnte es noch schlimmer kommen? Ich hatte doch gar nichts angestellt.
Sylvia und die Heimleiterin jedoch sahen das anders. Zwei Pfleger – Aufseher – hatten uns auseinander- und zum sogenannten Konfliktbewältigungsgespräch direkt in die Höhle der Löwen gebracht. Bernd, so stellte sich heraus, konnte nichts für seine Reaktion. Er war ein Borderline-Typ, besser oder beschönigt gesagt der Emotional Impulsive Typ. Er war sich keiner Schuld bewusst und stellte sich einfach stur. Beschämt lenkte ich ein – Gegenwehr oder Verteidigung zogen hier nicht. Wieder schluckte ich alles herunter, aber innerlich brodelte ich und wünschte mir, dass dieser unangenehme Mensch einfach tot umfiele.
War es allen wirklich so unmöglich, mich einfach nur in Ruhe zu lassen?
Hatten sie nicht genug mit sich selbst zu tun? Mussten sie ihre Probleme konsequent zu meinen machen?
Grübelnd schlich ich in mein Zimmer. Der Anblick, der sich mir dort bot, ließ mein Herz stehenbleiben. Ich hatte die Tür noch in der Hand und hielt mich an ihr fest. „Fatma! Was … was tust du denn hier?“, konnte ich nur stammeln.
„Man war der Meinung, dass ich dir ein bisschen zur Seite stehen könnte, Kleines. Ich habe schon vielen bei ihren Startschwierigkeiten geholfen. Sechs Monate bin ich nun schon hier.“ Während sie mein – unser – Zimmer in eine Hurrikan-Landschaft verwandelte, quasselte sie unablässig weiter. Sie roch nach Zigarette. Ich stehe gar nicht auf kalten Zigarettenmief. Als Fatma mit ihrem dicken Zeigefinger vor meiner Nase herumfuchtelte, bemerkte ich neben besagtem Zigarettengestank noch abgestandenen Kaffee. Schweres, benebelndes Parfüm ließ meine Lungenflügel zucken. Mir wurde schlecht. Ich schob sie grob von mir und stürmte an ihr vorbei ins Bad. Während ich mit dem Kopf über der Toilettenschüssel hing, fiel mein Blick auf mein Duschtuch.
„Du hast mein Duschtuch benutzt?“, quetschte ich mühsam hervor. Ich glaubte gelbe Schatten auf dem hellen Frottee entdeckt zu haben.
„Ach ja, Schatz. Du nimmst mir das hoffentlich nicht übel. Ich hatte meines verlegt. Aber wir wohnen ja jetzt zusammen“, erklärte Fatma unbekümmert und hing ihren hautfarbenen Riesen-BH an die Heizung.
Ich war sprachlos. „Hast … hast du auch meine Zahnbürste benutzt?“
„Iiih, das ist ja eine eklige Vorstellung! Nein, das würde ich nie tun!“, rief sie sichtlich angewidert.
Ich holte tief Luft, riss mich zusammen und verbrachte die nächste halbe Stunde damit ihr zu erklären, dass meine Sachen für sie unantastbar wären, und sie gelobte hoch und heilig, sich künftig daran zu halten. Ich war genervt.
Als ich am Morgen danach aus der Dusche steigen und mich abtrocknen wollte, ging mein Griff nach dem Handtuch ins Leere. Es war weg. Spontane Mordgelüste machten sich in meinem Kopf breit. Wie konnte diese dumme Nuss nur so frech sein? Ich sprang nass in meinen Jogginganzug und stürmte über den Flur zur Gemeinschaftsdusche. Sie schloss gerade die Tür hinter sich und hielt sich schnaufend am nahegelegenen Treppengeländer fest.
„Spinnst du? Du hast doch versprochen, dass du meine Sachen nicht mehr anfasst!“ Aufgebracht verpasste ich ihr einen derben Schubs. „Unfassbar!“
„Schrei doch nicht so, Kleines. Ist doch nur ein Handtuch.“ Wie zum Beweis hielt sie es hoch. Ich schnappte danach, doch sie zog ihre Hand wieder weg, als würde sie mich foppen wollen. Da brannte in meinem Schädel eine Sicherung durch. Mit der einen Hand schnappte ich nach dem Handtuch, mit der anderen stieß ich Fatma von mir. Sie geriet ins Taumeln, der obersten Stufe der langen Treppe gefährlich nahe. In ihren nassen Schlabber-Flip-Flops fanden ihre Füße jedoch keinen Halt. Mit einem entsetzten Schrei und viel Getöse segelte sie die zwanzig Stufen herunter, schlug zum Schluss mit dem Kopf gegen den eckigen Geländerabschluss und blieb regungslos liegen.
Nach dem ersten Schock verschwand ich schnell wieder in meinem Zimmer, gerade noch rechtzeitig, bevor alle anderen Türen aufgerissen wurden. Mein Gott, ich hatte gerade jemanden umgebracht! Mein Herz raste. Was sollte ich nur tun? Man würde mich sicher bald damit in Verbindung bringen. Angst, richtige Verfolgungsangst machte sich in mir breit.
Aber es passierte nichts.
Natürlich war Fatmas Tod Tagesgespräch in jeder Gruppensitzung und jedem Kurs. Niemand brachte jedoch mich mit der Sache in Verbindung. Man glaubte an einen Unfall, immerhin hatte sie anstatt des vorgeschriebenen rutschfesten Schuhwerks ihre quietschbunten Urlaubs-Flip-Flops getragen, die sie während des Fallens auf der Treppe verloren hatte. Obwohl ich anfänglich ein schlechtes Gewissen hatte, fühlte ich mich schnell sehr erleichtert. Fatmas Dauergequatsche hatte mir zugesetzt; nicht einmal mehr in meinem eigenen Zimmer hatte ich eine Rückzugsmöglichkeit gehabt. Ich erkannte, dass ich dieses Problem tatsächlich eigenständig gelöst hatte. Ich! In diesem Hochsicherheitstrakt! Über diese Vorstellung sinnierend nahm ich am nächsten Stuhlkreis teil – und stellte fest, dass mich die Probleme der anderen nicht mehr so berührten wie am Anfang. Ganz im Gegenteil.
Sie waren mir völlig egal. Mit einem wissenden Lächeln hörte ich ihnen zu.
Einige Tage nach diesem Vorfall stellte ich fest, dass der Verschwörungstheoretiker Bernd mich bespitzelte. Während alle anderen ihrem Tagesgeschäft nachgingen, lauerte er mir an jeder Ecke, bei jeder Gelegenheit und zu jeder Uhrzeit förmlich auf.
„Wieso bist du nicht aus deinem Zimmer gekommen, als Fatma die Treppe runtergeflogen ist? Hast wohl was damit zu tun? Komm, erzähl schon!“ Er kam mir mit dem Gesicht so nah, dass sich unsere Nasenspitzen fast berührten.
„Würdest du bitte etwas mehr Abstand halten? Ich fühle mich bedrängt“, wies ich ihn zurück.
„Du wirst ja rot!“, lachte er hämisch, stupste mich an der Schulter und ließ mich stehen.
Mit der Zeit entwickelte sich mein Klinik-Aufenthalt zum Spießrutenlaufen, ständig war ich bedacht, Bernd nicht unnötig über den Weg zu laufen. Meine Euphorie war in Paranoia umgeschlagen, und meine körperlichen Symptome wie Herzrasen, Zittern und Atemnot waren wieder da. Sogar noch schlimmer als vorher. Das Geschwafel im Stuhlkreis wurde wieder unerträglich, die Therapiesitzungen sinnlos. Ich fühlte mich in die Ecke getrieben wie eine trächtige Ratte. Die idiotischen Klinik-Regeln, die Freiheitsberaubung … was für ein Wahnsinn! Eines Abends betrat ich erleichtert mein Zimmer, froh, der Meute und Bernd entronnen zu sein, und mittendrin stand – Bernd. Er gab mir kaum Gelegenheit, mich von diesem Schreck zu erholen und fing sofort wieder an, mich auszufragen.
„Ich wills jetzt endlich wissen! Weißt du, dass ich seitdem nicht mehr richtig schlafen kann? Du bist schuld! Nur du! Ich weiß ganz genau, dass du es warst. Die arme Fatma. Gib es endlich zu!“ Sein Zeigefinger fuchtelte vor meinem Gesicht herum. Wo sollte ich mich verstecken, wenn ich schon in meinem eigenen Zimmer nicht in Sicherheit war? Ich rannte raus, zur Damen-Gemeinschaftsdusche, und hockte mich in einer Dusche in die Ecke. Zwei Minuten später flog die Tür auf und krachte an die gegenüberliegende Wand. Bernd.
„Hab dich! Los, aufstehen. Komm jetzt mit. Wir gehen zur Heimleitung. Ich will das geklärt haben!“ Er riss mich am Arm hoch und kugelte ihn mir fast aus.
„Aua, Mann! Hast du sie noch alle?“, schrie ich ihn an, dass es hallte. „Wieso ist das dein Problem?“
„Mein Problem?“, donnerte er mir ins Gesicht. Er packte mit der rechten Hand meinen Hals und drückte mich an die Wand, so dass ich nach Luft japste. „Wir wollen hier unsere Probleme lösen, nicht welche verursachen, du dämliches Huhn!“ Seine Unterlippe zitterte. Benebelt trat ich ihm so fest ich konnte in den Schritt. Das half. Ich konnte mich lösen und auf den Flur rennen, aber am Treppenabsatz hatte er mich schon wieder eingeholt. An dem gleichen Treppenabsatz, an dem auch Fatma ins Stolpern geriet. Er machte einen Satz auf mich zu, seine Hand erneut auf dem Weg zu meinem Hals. Als sie mich berührte, machte ich eine elegante Drehung nach rechts, wich aus, und gab ihm einen derben Schubs an die Schulter. Der reichte, um Bernd den gleichen Weg die Treppe hinunter nehmen zu lassen wie Fatma. Auch er blieb einfach liegen und bewegte sich nicht mehr. Dieses Mal jedoch konnte ich nicht mehr wegrennen. Er hatte viel zu viel Lärm gemacht, und so stand ich nur versteinert vor der Treppe und murmelte unverständliches Zeug. „Ich … ich habe ihn stolpern sehen und wollte ihn festhalten … aber er war viel zu schwer für mich …“ Für die anderen sah es so aus, als hätte ich einen schrecklichen Unfall mit angesehen. Wie hätten sie mir auch etwas nachweisen wollen?
Der Tod hatte doch etwas seltsam Beruhigendes.
Mit Freude nahm ich an der nächsten Töpferstunde teil. Ich versank gedanklich derart in meinem Lehmhaufen, dass ich ohne Probleme eine wunderschöne Vase gestaltete. Ich sang leise vor mich hin, als ich mit dem nassen Zeigefinger leichte Vertiefungen in den Rand drückte. Wieder hatte ich es geschafft, mein Problem selbst zu lösen. Plötzlich kam einer der Pfleger-Aufseher auf mich zu und flüsterte mir zu, dass die Heimleiterin mich in ihrem Büro sehen möchte. Irritiert blickte ich von meinem Kunstwerk auf. „So? Weswegen denn?“ Unruhe befiel mich. Der Pfleger begleitete mich, und im Büro der Heimleiterin wartete eine Polizistin. Wieder musste ich meine Unfallgeschichte erzählen. Aber das machte nichts, ich kannte sie bereits auswendig.
„Tja, Frau Brinkner … eine schlimme Geschichte. Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie mitansehen mussten, wie jemand vor Ihren Augen zu Tode stürzt. Der arme Mann hat sicher noch versucht, sich an Ihnen festzuhalten?“, fragte die Beamtin sachlich.
„Was … nein, das hat er nicht geschafft“, entgegnete ich verwundert.
„Nun, wir haben in seiner Hand eine filigrane silberne Halskette gefunden, mit einem heiligen Rafael als Anhänger. Vermissen Sie eventuell Ihre Halskette?“ Die Polizistin schien mir direkt ins Gehirn zu sehen. Ich konnte nichts dagegen tun – mir wurde unglaublich heiß. Ich fing an zu zittern, warf die Arme um mich, schrie, dass ich nichts dafür könnte und warum die ganze Welt auf mir herumhacken würde. Plötzlich wurde ich von hinten gepackt und hochgehoben. Ich trat um mich, aber vergeblich. Der Pfleger hatte mich im Sicherheitsgriff, und ich erinnere mich nur noch an das Pieken im rechten Oberarm.
Als ich wieder zu mir kam, war mir noch ziemlich schwummerig. Ich konnte mich nicht bewegen, es fühlte sich an, als wäre ich festgegurtet.
„Schon wieder so ein Traum“, murmelte ich vor mich hin. Ich war mit einer kuscheligen Decke zugedeckt, und es war so ruhig, dass ich das Blut in meinen Ohren rauschen hören konnte. Wenn das doch so bleiben könnte, dachte ich sehnsüchtig. Diffuses bläuliches Licht kam von irgendwo her. Irgendwann holte mich das Klimpern eines Schlüsselbundes zurück. Der Pfleger Michael kam mit einem Tablett ins Zimmer.
„So, heute Mittag gibt es Kartoffelknödel und Gulasch. Komm, Melanie, ich helfe dir.“
„Micha, warum kann ich mich nicht bewegen?“, hörte ich mich lallen.
Der Micha. Er war immer so nett. „Ich fürchte, das wird jetzt eine ganze Weile so bleiben, Melanie. Zu deinem Schutz bleibst du jetzt erst einmal im Bett. Schade, ich dachte, du packst das hier.“ Er steckte mir mit einer Plastikgabel ein Stück Kloß mit Sauce in den Mund. Ich runzelte die Stirn – wie meinte er das? Meine Probleme hatte ich doch ganz alleine gelöst, trotz aller Schwierigkeiten. Ich war stolz auf mich. Nun bekam ich nur noch Einzelsitzungen mit Sylvia. Aus dem verhassten Stuhlkreis war ich raus und mein Terminplan war wieder überschaubar.
Feste Mahlzeiten, geregelte Uhrzeiten – endlich hatte ich Ruhe.