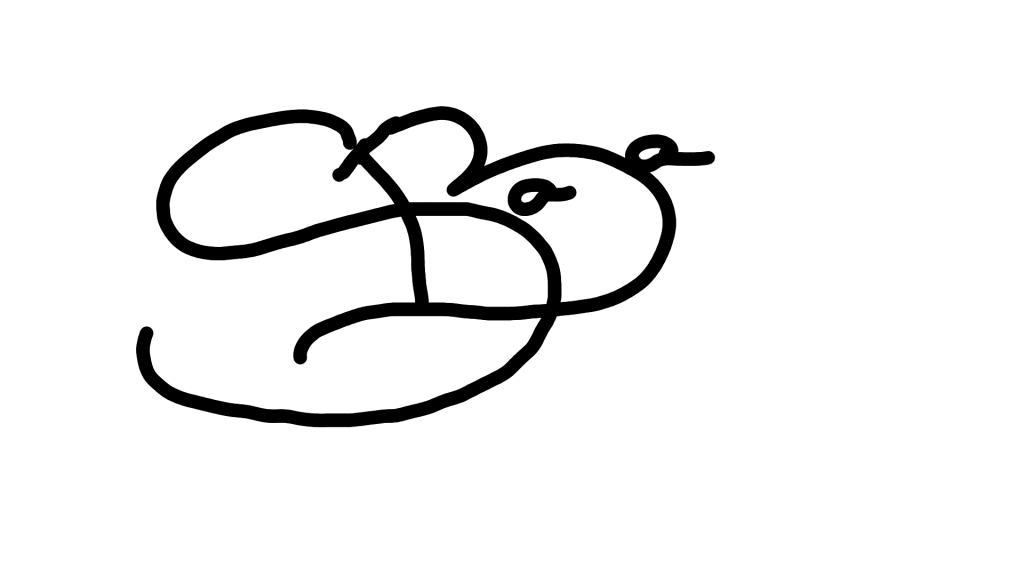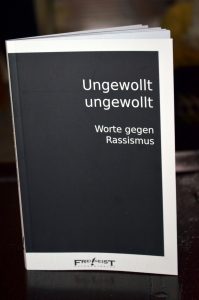„Der Krieg ist der Vater aller Dinge.“
(Heraklit, altgriechischer Philosoph, 6./5. Jh. v. Chr.) (1)
(Foto: ELG21 / pixabay)
Lesedauer: ca. 10 min.
24. Februar 2022
Es hätte der Trailer eines Kriegsfilms sein können, aber tatsächlich war ich beim Zappen bei den Nachrichten hängengeblieben. Russische Soldaten machten sich mit Panzern und anderem schweren Gerät bewaffnet auf den Weg in die Ukraine. Krieg in Europa? Im 21. Jahrhundert? Sollte das nicht seit achtzig Jahren Geschichte sein?
Naiv, das zu glauben.
Irgendwo auf der Welt findet immer irgendein Krieg statt. Nur tobt er meistens weiter weg und berührt uns nicht. Wir glauben, wir seien so hochentwickelt, dass derart archaische Methoden ausgerottet seien, aber das ist ein Trugschluss. Krieg gehört zu uns Menschen. Und nun greift diese ferne, abgelegt geglaubte Realität mit langen Fingern in unser tägliches Leben ein. Dabei stellt sie sich für jeden von uns anders dar.
Die Ukrainer sehen ihre mühsam erkämpfte Freiheit nach drei Jahrzehnten erneut in Gefahr. Die jüngeren von ihnen kannten bisher nur ein Leben in absoluter Freiheit und Unabhängigkeit, durften leben, lernen, reisen, ihre Meinung frei äußern, sich weiterentwickeln, wie es ihnen beliebte. Vielen waren Kriegsfilme wie „Full Metal Jacket“, „Schindlers Liste“ oder „Der Soldat James Ryan“ bekannt; wem die Handlung zu viel wurde, der konnte den Film einfach ausschalten.
Dieser Krieg aber lässt sich nicht einfach abstellen.
Und er zieht auch nicht zügig vorbei wie ein großes Unwetter. Die Welt der Ukrainer zerfällt. Auch sie hatten Pläne wie wir alle. Wollten ein Haus bauen, eine Familie gründen, studieren, die Welt erkunden … Oder sie hatten all das schon und genossen einfach ihr Leben.
Bumm! Mit einem Schlag war alles vorbei. Alles weg, einfach so.
Weil jemand anders beschlossen hat, sich einfach zu nehmen, was ihm nicht gehört.
Die Familien, die sofort flohen, sind vielleicht heute noch zusammen. Aber sie haben ihre Existenz verloren und sind auf fremde Hilfe angewiesen. Die Familien, die etwas länger ausgehalten haben, sind heute zum Großteil voneinander getrennt. Alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht mehr verlassen, weil sie im Krieg mitkämpfen müssen. Ob sie wollen oder nicht. Viele haben ihre Familien auf den weiten Weg in den sicheren Westen geschickt. Die Menschen wissen nicht, ob sie ihre Frauen, Männer, Kinder, Mütter oder Väter jemals wiedersehen werden. Kinder vermissen ihre Väter. Söhne über achtzehn – zum Teil selbst noch Kinder – ihre Mütter.
Unzählige Kinder wurden von ihren Eltern allein auf die Reise ins Ungewisse geschickt.
Mütter und Frauen hatten es schon über die Grenze geschafft und haben kurz darauf weinend den Rückzug angetreten, weil sie ihre Männer und Söhne nicht alleine sterben lassen wollen. Manch einer mag sich an dieser Stelle mit der flachen Hand an die Stirn schlagen, aber so lange wir nicht in der gleichen Haut stecken, können wir uns kein Urteil über diese Reaktion anmaßen.
Für mich persönlich war es schon schlimm, meinen damals 19-jährigen Sohn in einen Zug zu setzen, der ihn zu seinem Ausbildungsplatz ans andere Ende der Republik brachte. Aber eines war sicher: Ich würde ihn wiedersehen.
Meine schlesische Urgroßmutter glaubte ihren 18-jährigen Sohn an den Zweiten Weltkrieg verloren zu haben, als er 1942 in die Deutsche Wehrmacht eingezogen wurde. Er war gelernter Konditor, aber nun musste er kämpfen. Und er wurde gezwungen zu töten. Nach der Schlacht von Stalingrad wurde er als Strafgefangener in einen sibirischen Gulag (Kriegsgefangenen-/Arbeitslager) verschleppt. Erst 1948, drei Jahre nach Kriegsende, wurde er entlassen – weil er durch die hygienischen Verhältnisse sowie die Mangelernährung schwer krank geworden war. Seine Heimat Schlesien existierte nicht mehr, und so kam er zunächst in einem Auffanglager für Flüchtlinge in Bremen unter. Er glaubte seine Familie tot und wusste nicht, dass seine Eltern es mit seinen drei Geschwistern nach einer dreiwöchigen Flucht und vielen Strapazen und Entbehrungen ins Emsland geschafft hatten. Ein Wunder, dass die Familie nach gut sechs Jahren wieder vereint werden konnte. Heute nicht mehr vorstellbar? – Doch. Es herrscht bereits Krieg.
Was wird die Menschen in der Ukraine nun erwarten?
Manche Familien sind geblieben. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Manche kämpfen freiwillig und stellen sich wie der tapfere David dem übermächtigen Goliath in den Weg (gewonnen hat übrigens David). Andere haben nicht transportfähige Angehörige oder möchten ihre Liebsten nicht alleinlassen. Manche leben vielleicht in Gegenden, die noch nicht direkt beschossen werden, und sind einfach unschlüssig. Immerhin macht es einen großen Unterschied, ob Flucht der letzte Ausweg ist oder man aktiv die Entscheidung treffen muss, sein Hab und Gut einfach aufzugeben. Man hofft, dass alles vorbei ist, bevor es die eigene Ortschaft trifft.
Ähnlich geht es meiner ehemaligen Kollegin, die ich über Facebook wiederfinden konnte. Sie wohnt in einem Vorort von Zaporizhzhya, nur ca. 252 Kilometer Luftlinie von Charkiv und ca. 201 Kilometer von Mariupol entfernt. Sie und ihre Tochter verbringen die meiste Zeit des Tages im Flur, da er keine Fenster hat. Nahe ihrer Wohnung gibt es einen Bunker, in den sie bei Fliegeralarm flüchten. Beide arbeiten online, so dass sie weiterhin ihr Geld verdienen können – solange die Internetverbindung noch besteht. Aber sie spricht auch von traumatisierten Nachbarn, von Gräueltaten und Blutvergießen. Täglich überlegen sie neu, ob sie sich nun auf den Weg machen oder nicht.
„Ich würde sofort meine Sachen packen und abhauen.“
Sprüche wie diesen habe ich in unseren Gefilden häufiger gehört. Aber so einfach ist das nicht. Man hat sich schließlich ein Leben aufgebaut – und es ist niemandem so wenig wert, dass man es von jetzt auf gleich hinter sich lässt. Wer von uns wäre schon so abenteuerlustig, einfach ohne Ziel ins Unbekannte aufzubrechen, mit nichts als einem Rucksack oder einem kleinen Koffer? Zudem noch in ein Land, dessen Sprache man möglicherweise nicht spricht? Solange das Dach über unserem Kopf noch da ist, würde wohl jeder von uns noch weiter durchhalten – und einfach hoffen, dass es bald vorbei ist. Und auch, wenn die Flucht heute nicht mehr drei Wochen dauert, so sind es doch viele Tage und große Strapazen. Viele Flüchtenden müssen zu Fuß gehen, haben während der ganzen Zeit kein Dach über dem Kopf. Manche berichten von erfrorenen Menschen auf ihrem Weg.
Die Hafenstadt Mariupol ist eingekesselt und bereits nahezu dem Erdboden gleich. Kaum ein Stein steht noch auf dem anderen. Es gibt keinen Strom mehr, keine Heizung, kein Wasser (mittlerweile trinkt man Abwasser), kaum noch Lebensmittel – ein Zustand ähnlich dem kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Notdürftig bedeckte Leichen liegen verstreut herum. Männer graben mit Spaten Löcher in Rasenflächen direkt neben Straßen, um wenigstens einige der Toten zu begraben. Man weiß längst nicht mehr, wohin man sie bringen soll.
Ich muss an die Erzählungen meiner Großmutter denken, die während des Zweiten Weltkrieges in Wuppertal zur Schule ging. Ständig gab es Fliegeralarm, immer wieder mussten sie sich im Schulbunker verstecken. Nach dem Krieg suchten die Mütter in den Trümmern nach Brauchbarem. Die Kinder trieben sich an Bahngleisen herum, wo sie Essensreste sammelten, die von den Fahrgästen aus dem Fenster geworfen wurden. Und ich weiß nun auch, was Blutsuppe ist.
Es gibt so viele verschiedene Einzelschicksale, dass die Liste lang ist. Hoffen wir, dass die Welt nicht wieder so weit abrutscht. Ja, genau – die Welt. Nicht nur die Ukraine brennt – wir sind alle betroffen. Direkt oder indirekt.
Was macht der Krieg mit uns und mit der Gesellschaft?
Die Flüchtlinge kommen in Scharen zu uns und werden mit offenen Armen empfangen. Die europäischen Länder (und nicht nur sie!) sind näher aneinandergerückt, man versucht gemeinsam zu helfen. Viele Hilfsorganisationen und auch Privatpersonen haben sporadisch und unbürokratisch alle Hebel in Bewegung gesetzt, die Menschen aufzufangen. Viele Geflüchtete sind traumatisiert und werden Jahre brauchen, das Erlebte zu verarbeiten. Unzählige freiwillige Psychologen und Sozialarbeiter sind an den Grenzübergängen im Einsatz und versuchen, einen ersten Strohhalm zu reichen. Die Bereitschaft der Bürger, den Geflüchteten eine allgemeine Hilfestellung bei sämtlichen Wegen zu leisten, ist enorm. Im Gegensatz zu der Situation im Jahre 2015 legen wir gerade noch eine Schüppe nach. Warum ist es heute anders als damals? Ist uns die ukrainische Kultur näher als die syrische? Oder sind wir dieses Mal einfach besser in Übung?
Letztendlich zählt, dass wir gelernt haben, wie man es besser macht. Und dass ein gutes Miteinander das Leben aller schöner macht.
Allerdings ruft die Situation auch solche Individuen auf den Plan, die sich am Leid der Menschen bereichern wollen und an den Grenzen auf leichte Beute hoffen. Zuhälter versuchen, alleinstehende junge Frauen abzufangen und locken sie mit Geld und einem Wohnungsangebot in die Prostitution. Man kann nur hoffen, dass die Damen pfiffig genug sind, nicht darauf hereinzufallen.
Die Konsequenzen für uns Westler sind vielseitig und weitreichend.
Durch die Sanktionen gegen Russland steigen die Spritpreise und Beförderungskosten, manche Arbeitnehmer können sich kaum noch den Weg zur Arbeit leisten. Das betrifft auch den Lieferverkehr für Nahrungsmittel und andere Produkte. Weizen oder Sonnenblumenöl, alles, was wir hauptsächlich aus der Ukraine und aus Russland beziehen, wird zur Mangelware. Damit steigen auch die Nahrungsmittelpreise. Was wiederum zu Hamsterkäufen führt, da es immer noch einige Unverbesserliche gibt, die das Spiel von Angebot und Nachfrage noch nicht verstanden haben. Und die damit unbewusst (oder ignorant) zur Verteuerung der Produkte beitragen. Aber die Regale sind nicht nur wegen Lieferschwierigkeiten und Notkäufen leer – manche Leute haben auch einfach ihren Großeinkauf einer Hilfsorganisation mitgegeben, die die Ukraine mit dem Nötigsten versorgt. So teilen wir das, was wir haben, mit denen, die es nötiger brauchen als wir – auch, wenn wir auf den Nachschub etwas länger warten müssen.
Aber nicht alle sind so geduldig. Den Supermärkten vorzuwerfen, sie hätten ihre Lieferanten nicht im Griff, ist im Moment der falsche Ansatz. Nimmt man von fünf Stück Schokolade fünf weg, lässt sich nicht im Handumdrehen ein sechstes aus dem Lager herbeizaubern. Zumal die Produkte ja billig sein müssen. Diese stammen jedoch aus Niedriglohnländern – womit wir wieder beim Transportweg und hohen Spritpreisen wären. Und der Tatsache, dass die Ukraine gerade andere Sorgen hat.
Würden nicht manche Mitbürger für die Apokalypse horten und anderen etwas übrig lassen, müssten Geringverdiener sich nicht so viele Sorgen um die nächste Mahlzeit machen. Man könnte auch einfach von regionalen Anbietern kaufen. Dann wäre für alle gesorgt.
Die Krisensituation lässt auch den Rassismus wieder aufblühen.
Falschinformation durch soziale Medien oder Mund-zu-Mund-Propaganda führen dazu, dass Menschen mit osteuropäischem Akzent diskriminiert oder angegriffen werden. Aber wer kann schon von sich behaupten, sämtliche slawischen Sprachen auseinanderhalten zu können? Peinlich sollte es nur für denjenigen sein, der solches Gedankengut äußert. Mischbeziehungen verschiedener Nationalitäten gab es immer schon, und wer weit genug in seinem Stammbaum in die Vergangenheit forscht, wird so manche Überraschung erleben.
Abgesehen davon ist nicht jeder Russe automatisch ein Putin-Befürworter. Viele distanzieren sich von ihrer Regierung und verlassen sogar nun ihr Heimatland (in dem kein Krieg tobt!). Es ist einzig und allein Putins Feldzug.
Die Welt, wie wir sie kennen, bricht gerade auseinander. Die Situation erfordert Umdenken, neue Wege – und ganz viel Empathie. Bei uns mögen wieder einmal Toilettenpapier und Weizenprodukte fehlen, aber nebenan werden Menschen aus ihrer Heimat vertrieben oder getötet.
Jeder von uns braucht irgendwann einmal Hilfe. Möglicherweise von jetzt auf gleich. Von Menschen, die wir nicht kennen.
Rassismus hat in dieser Welt keinen Platz.
***
Fußnote:
von Sandra Barbosa da Silva