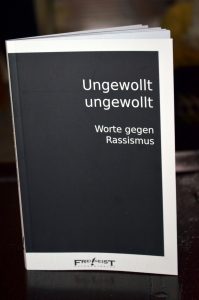Vorsicht: Nichts ist, wie es scheint.

„Person, die sich großer Beliebtheit erfreut“
(Foto: pixabay / OpenClipart-Vectors)
Lange habe ich mich gefragt, wie manche Menschen es schaffen, überall beliebt zu sein. Sie gehen mit einer Leichtigkeit durchs Leben, die sie nirgendwo anecken lässt. Kommen sie in einen Raum, ziehen sie die Blicke und Sympathien der anderen auf sich, sind sofort umringt.
Als Kind war ich neidisch. Ich wollte doch auch dazugehören, wollte wie andere viele Freunde haben und immer nur Sonnenschein ernten. Warum klappte das nicht?
Ganz einfach: Ich war nicht sie.
Everybody’s Darling – bei diesem Begriff mag man an ein kleines Mädchen denken, mit blonden Locken im süßen Kleidchen, welches so brav und zauberhaft ist, dass man es einfach liebhaben muss.
Oder an einen erwachsenen Menschen, der so nett ist, dass ihm alle Herzen einfach nur so zufliegen. Jemanden, den man gern um sich hat.
Oder auch einfach nur an eine Person, die alles tut, um jedem zu gefallen – und das ist nicht nur Frauensache.
Dieser Gedanke verhalf mir zur Kurskorrektur – die Frage musste nicht lauten „Warum klappt es mit meiner Beliebtheit nicht?“, sondern „Warum sollte ich jedem gefallen wollen?“
Auch, wenn ich selbst eine Weile lang versuchte, um des Friedens willen ein Darling zu sein, so war der Drang mein Ich zu finden größer, als zu der Person zu werden, die andere von mir erwarteten. Das Leben eines anderen zu leben anstatt mein eigenes, besser gesagt „gelebt zu werden“, verursachte großes Unbehagen.
Schließlich ist man der einzige Mensch, vor dem man nicht weglaufen kann, man muss also irgendwie mit sich selbst klarkommen können. Und das ein ganzes Leben lang.
An welchen Eigenschaften kann man einen Darling erkennen?
- wirkt unschuldig
- schreit niemanden an
- tut, was man ihm/ihr aufgetragen hat
- hinterfragt nicht (öffentlich), diskutiert nicht, gibt niemals Widerworte
- akzeptiert immer die Meinung der anderen
- stellt eigene Wünsche für die der anderen zurück
- versucht immer, es allen recht zu machen, möchte allen gefallen
- Perfektionismus
- höflich
- ist süß, gutaussehend
- lustig
- hat viele Freunde
- schwimmt immer mit dem Mainstream
- versucht sich überall einzubringen
- ist berechnend
- tut auf charmante Art alles, um seinen Willen zu bekommen
- usw. – auch hier gibt es unzählige Schattierungen
Natürlich treffen diese Eigenschaften nicht alle auf jeden Darling zu – manchmal ist es nur eine einzige. Andere Lebensumstände, andere Familiensituation – Beweggründe und Ausprägungen sind mannigfaltig; oft erkennt man einen Darling nicht einmal als solchen.
Generell mag man denken, Darlinge hätten es im Leben einfacher; sie seien begnadet, auserwählt oder hätten etwas Magisches an sich, das andere einfach anziehen muss – möglicherweise ist man auch eifersüchtig: Was hat diese Person, das ich nicht habe? Wieso habe ich nicht solches Glück?
Sei dir sicher – du möchtest nicht tauschen. Der Preis ist zu hoch.
Eine ganze Weile magst du mit diesem Verhaltensmuster gut durchs Leben kommen (und so hat man es ja schließlich gelernt), du glaubst, du schwimmst auf der Erfolgswelle, hast mit niemandem Stress, eckst nirgendwo an, kurzum: Du wirst von allen gemocht – zumindest denkst du das.
Eines Tages wird dir jedoch bewusst, dass dein Leben ganz schön anstrengend ist und du kein bisschen Zeit für deine eigenen Wünsche hast. Möglicherweise bemerkst du erste emotionale oder körperliche Unpässlichkeiten, bekommst manche Dinge einfach nicht in den Griff. Du hetzt von A nach B und von Termin zu Termin, um die Erwartungen zu erfüllen, die andere an dich stellen. Um deine eigenen zu erfüllen, fehlt dir die Zeit. Dir wird klar, dass du dich oft auf eine Weise verhältst, die gar nicht zu dir passt. Unangenehme Situationen wiederholen sich, und vielleicht wirst du sogar zu einem „shit magnet“: „Wieso passiert das immer mir?“
Das alles fördert starken inneren Stress und Druck; man hat irgendwann ordentlich „Dampf auf dem Kessel“, der sich eines schönen Tages einen Weg nach draußen suchen muss – entweder in Form eines emotionalen Ausbruchs oder durch eine körperliche Krankheit.
Migräne? Herzrhythmusstörungen? Bluthochdruck? Magenschleimhautentzündungen?
Fühl einmal tief in dich hinein, ob du nicht vielleicht ein Teilzeit-Darling sein könntest.
„Ha, ich doch nicht. Ich muss nicht jedem gefallen! Mir ist egal, was andere über mich denken.“
Bist du dir dessen wirklich absolut sicher? Oder bist du bei irgendwem, in irgendeinem Lebensbereich, in irgendeiner Situation eventuell doch nicht ganz du? Vielleicht ist es dir egal, was sie über dich denken. Möglicherweise ist es dir aber nicht egal, ob du mit jemandem Stress oder Ärger bekommst, nur weil du an deinem Ich-Sein festhältst.
Das ist mir auch passiert. Und es hat lange gedauert, bis ich erkannt habe, dass ich mich damit nur immer wieder in die gleiche Endlosschleife reite.
Wenn man nicht schonungslos ehrlich zu sich selbst ist, kommt man an die verborgenen Schätze nicht heran.
Was sind mögliche Hintergründe für diese Selbstverleugnung?
- Ich möchte andere nicht verletzen.
Eine löbliche Einstellung, aber sie beruht meistens nicht auf Mitgefühl (das wäre gesund), sondern auf Angst (das ist ungesund). Diese Aussage ist oft ein bewusster oder unbewusster Vorwand; in Wahrheit habe ich Angst, selbst verletzt zu werden und tue daher alles, damit mein Gegenüber nicht negativ auf mich reagiert.
Ein kleines Kind entwickelt so z. B. einen Schutzmechanismus seinem Umfeld gegenüber. Wenn es sich immer abgewiesen, beschimpft oder nicht geliebt fühlt (was nicht bedeutet, dass es immer so ist; das Kind interpretiert es nur so), entwickelt es Verhaltensweisen, die ihm die Zuneigung der anderen sichern.
Man verbiegt sich also für andere, stellt sich selbst in den Hintergrund. Die Seele kann sich nicht ausdrücken. Schlimmstenfalls verliert man die Verbindung zu sich selbst, wird zur Marionette anderer und bekommt nichts mehr auf die Kette. - Ich möchte keinen Ärger.
Siehe erster Punkt; Schutzmechanismus. - Wenn ich beliebt bin, habe ich viele Freunde, man kümmert sich um mich.
= dann bekomme ich die Aufmerksamkeit, die ich mir so sehr wünsche (mangelnde Selbstliebe, ich mag mich selbst nicht genug). - Wenn ich meine Meinung sage, werden andere sauer oder mögen mich nicht mehr.
= damit mache ich mich unbeliebt. - Das macht man halt so. Alle tun das. Es wird von einem erwartet.
Man hat es so beigebracht bekommen und bisher nicht hinterfragt, warum das so ist. Dabei sind wir nicht auf diese Welt gekommen, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Wir sind hier, um unsere eigenen Erwartungen an uns selbst, an das Leben zu erfüllen. Und wenn es uns gut geht, können wir uns auch gut um andere kümmern.
Jeder hat individuelle Erwartungen, die man nicht unbedingt mit denen der anderen vergleichen kann. Jedoch tun wir genau das – aber ein roter Apfel wird niemals zur grünen Birne. - Ich will einfach nur Erfolg und dafür tue ich alles.
Ich verstand, dass ich, um ein Darling zu sein, möglichst meine eigenen Bedürfnisse und die Art, wie ich sein wollte, zurückstellen musste. Was andere wollten, schien wichtiger. Was ich nicht verstand war, warum die anderen im Gegenzug nicht auf meine Bedürfnisse achteten. Wenn doch immer die anderen wichtiger waren, musste sich doch auch jemand für mich einsetzen? Sollte es nicht zumindest eine Balance geben, eine Harmonie, ein Geben und Nehmen?
Heute weiß ich, dass sie das gar nicht konnten, weil ich es nie ausgesprochen habe. Ich wollte ja „Harmonie“ um jeden Preis.
Warum ist uns unser eigenes Wohlergehen bloß so unwichtig?
Ist es nicht. Aber die Angst vor den Konsequenzen ist zu groß. Dann nervt vielleicht die Mutter, es gibt Zoff mit dem Vater, die Beziehung stresst herum, die Kinder sind zu anstrengend, der Arbeitgeber doof – alles keine angenehmen Aussichten. Der Mensch ist ein harmoniebedürftiges Wesen. Und so versuchen wir so zu sein, wie andere uns haben wollen (zumindest denken wir das). Am Anfang ist da nur die Familie. Dann kommen Freunde dazu. Anschließend noch Kollegen und so weiter und so fort; die Truppe derer, die uns mögen sollen, wird immer größer. Und wir müssten uns zu einem keltischen Knoten verdrehen, um unser vermeintlich harmonisches Umfeld aufrechtzuerhalten. Damit werden wir jedoch zum Lügner, vor allem vor uns selbst. Wir haben uns eigenständig ins Aus geschossen und uns damit eine Welt des Scheins erschaffen, nicht des Seins.
Durch das ständige Sich-für-andere-verbiegen können wir nicht authentisch sein. Da wir aber nur das anziehen können, was wir aussenden, ist unser Umfeld genau das – ein völlig verzerrtes Bild von uns selbst. Die Freundschaften sind oberflächlich und oft nicht echt. Sagt so ein Darling einmal offen seine Meinung, entliebt sich unser Gegenüber recht schnell („so bist du doch sonst nicht, damit komme ich gar nicht klar“).
Kein Wunder, dass wir uns nicht wohlfühlen.
Wie wir dahingekommen sind, wissen wir irgendwann nicht mehr, wir betreiben Schadensbegrenzung.
Was ist nun genau „Harmonie“?
„Dass alles ruhig ist, alle sich gut verstehen und liebhaben.“ – Tun sie das?
Positiv existiert nicht ohne Negativ. Harmonie bedeutet die Balance zwischen beiden Aspekten, im besten Fall ohne großartige Pendelschwünge in die eine oder andere Richtung. Wer einmal ein Pendel in der Hand hatte weiß, dass es nach dem Schwung in die eine Richtung (z. B. „Positiv“) mit genau der gleichen Kraft auch in die andere („Negativ“) schwingen muss. Immer nur zum Positiven hin zu streben, kann also nicht funktionieren. Und noch schlimmer: Je weiter wir ausholen und das Positive mit aller Macht erreichen wollen, desto weiter wird auch der Pendelschwung ins Negative sein. Das andere darf und muss also da sein.
Wenn du morgens ins Büro kommst, sich alle grinsend einen guten Morgen wünschen und du trotzdem das Gefühl hast, man könne die Luft durchschneiden, dann würdest du dies nicht als harmonisch bezeichnen, auch wenn es den Anschein hat.
Harmonie bedeutet, dass man auch einmal Grenzen setzt, etwas verneint, oder einen Vorschlag ablehnt, ohne dass uns der andere gleich dafür verurteilt oder sich zurückgewiesen fühlt. Dass man vielleicht gemeinsam einen anderen Weg findet, der beide glücklich macht. Harmonie bedeutet, den Anderen so zu nehmen wie er ist, ohne ihn verbiegen zu wollen.
„Wenn es so einfach wäre, diese Ängste und Interpretationen abzuschalten, würde das ja jeder tun und niemand müsste sich mehr verbiegen.“
Dies wirft die Frage auf, wie man überhaupt dazu gekommen ist, sich selbst verleugnen zu müssen. Die oben erwähnten Hintergründe sind nur das, was ganz offensichtlich obenauf liegt, sind die aktuellen Geschichten zu dem Ur-Erlebnis, das wir so lange wieder durchmachen, bis wir unsere Lektion gelernt haben. Die Spitze unseres persönlichen Eisbergs sozusagen.
„Die Ursache liegt meistens in der Kindheit.“
Oder noch weiter zurück.
Jedes nicht bewältigte emotionale Erlebnis speichern wir zusammen mit der erfahrenen Situation ab.
Als kleines Kind sind wir darauf angewiesen, dass uns jemand unsere Emotionen erklärt, uns hilft, ein Erlebnis durchzustehen und zu verarbeiten. Im Erwachsenenalter können wir vielleicht über unsere damalige Reaktion lachen, aber als wir in diesem Erlebnis steckten, waren wir verzweifelt. Sprüche wie „ist doch alles gar nicht so schlimm, jammer nicht“ sind nicht hilfreich. Man lernt daraus nur, dass die eigenen Empfindungen nicht wichtig sind.
Irgendwann unterdrückt man das Bedürfnis, sich mitzuteilen, packt die Ängste und Sorgen in einen großen Sack in die unterste Kellerecke der Psyche und hofft, dass sie nie wieder hochkommen.
Aber das tun sie.
Im Laufe unseres Lebens sammeln wir immer mehr Geschichten zum gleichen Ereignis; wie weitere Beweise bestätigen sie unser Erlebnis – und unser Schatten-Sack wird immer schwerer. So lange wir dieses Thema aber nicht auflösen, schleppen wir es schlimmstenfalls unser ganzes Leben lang mit uns herum. Oft erinnern wir uns nicht mehr an das erste Mal, und so wird es zu einem Programm, das abgespult wird, sobald einer auf den passenden Knopf drückt.
„Wenn du das und das machst, dann hab ich dich nicht mehr lieb.“ – Emotionale Erpressung als Druckmittel gegen ein aufmüpfiges Kind, mit dem man sich überfordert fühlt. Das Kind kann sich nur schützen, indem es sein Ego an die Seite stellt oder es gleich ganz unterdrückt. Die Eltern bekommen ihr Vorzeige-Kind, der Teenager ist der höfliche Musterschüler, der Chef hat einen unverzichtbaren Mitarbeiter, der seine linke und rechte Hand darstellt.
Jahrzehnte später sucht sich das echte Ich seinen Weg nach draußen – die Krise ist vorprogrammiert. Perfektionismus, Paranoia, Was-wäre-Wenn Szenarien, extremes Sicherheitsbedürfnis.
Das bedeutet nicht, dass wir alle eine schwere Kindheit hatten. Unsere Bezugspersonen haben/hatten ihre eigenen Päckchen zu tragen und mussten darüber hinaus noch versuchen, einen neuen Menschen auf die Herausforderung Leben vorzubereiten. Weil wir vielleicht häufiger mal zurückgewiesen wurden, als wir Aufmerksamkeit gebraucht hätten, wurden wir nicht weniger geliebt. Ein kleines Kind jedoch ist noch sehr verletzlich, versteht die Situation nicht und wenn es ihm niemand erklärt, bleibt es mit seinen überwältigenden Emotionen allein.
Wie bereits erwähnt, muss das erste Erlebnis nicht in der Kindheit liegen. Wir können auch im Erwachsenenalter etwas erleben, das einen neuen Auslöser, einen Trigger, schafft.
„Aber wenn jeder so ein Darling wäre, gäbe es keine Kriege mehr.“
Ganz im Gegenteil. Es gibt Kriege, eben weil die Menschen nicht authentisch sind, weil sie Ängste und Sorgen haben, weil sie aus einem Mangeldenken heraus meinen, sich bereichern zu müssen, weil sie interpretieren, anstatt miteinander zu sprechen und so weiter und so fort.
Wie soll die Energie einer Nation in Balance sein, wenn es ihre einzelnen Mitglieder nicht sind?
Der Weg zu einer besseren Welt ist also erst mal der Weg zurück zu uns selbst. Nur so können wir wirklich etwas bewirken.
Wie kommt man aus der Nummer wieder raus?
Zu sich selbst zu finden bedeutet nicht, dass man die Sau rauslässt, jeden vor den Kopf stößt und nur noch egoistisch unterwegs ist. Es bedeutet genau zu wissen, was man möchte und was nicht und dieses auch ehrlich zu sagen. Fehler einzugestehen, durch die Brille des anderen zu schauen und sich selbst und die Welt nicht allzu ernst zu nehmen:
- Dinge offen ansprechen, auf eine Lösung hinarbeiten
- den anderen anhören, aber auch die eigene Meinung sagen „das passt für mich nicht, lass es uns doch so und so machen“
- nichts interpretieren, lieber nachfragen (aufregen kann man sich dann immer noch) – oft ist es ganz anders, als wir dachten – so kommen die Missverständnisse ins Spiel. Je genauer wir hinterfragen und formulieren, desto besser wird unsere Wahrnehmung
- formuliere deine Aussagen treffend, lass nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten offen
- keine Angst vor den Konsequenzen haben; Menschen, die dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, wollten nie dein Bestes (nur ihr eigenes)
- Energie- und Schattenarbeit, um die dichten, negativen Energien wie Ängste und nervige Emotionen, die dich immer wieder blockieren, umzuwandeln und sie positiv nutzen zu können. Sind die Abdrücke erst einmal aus deinem persönlichen Feld entfernt, können die Energien wieder frei fließen. Es stellt sich echter Frieden ein.
Wenn du wirklich DU bist, bist du echt, sagst die Wahrheit. Damit ziehst du andere authentische Menschen an, es ergibt sich ein ganz anderes Umfeld, mit gegenseitigem Verstehen, Hilfsbereitschaft, konstruktiver Kritik und einem wohlwollenden Miteinander. Jeder lässt den anderen sein, wie er ist – nur so entwickelt man sich wirklich weiter.
Dann bist du wirklich GUT.
Die ursprüngliche, vollständige menschliche Seele ist immer wohlwollend, kann aber auch sehr bestimmt und nachdrücklich „Nein“ sagen. Dies bedeutet aber noch lange keinen Streit. Es bedeutet einfach eine andere Meinung.
Everybody’s Darling is Everybody’s Fool.
von Sandra Barbosa da Silva
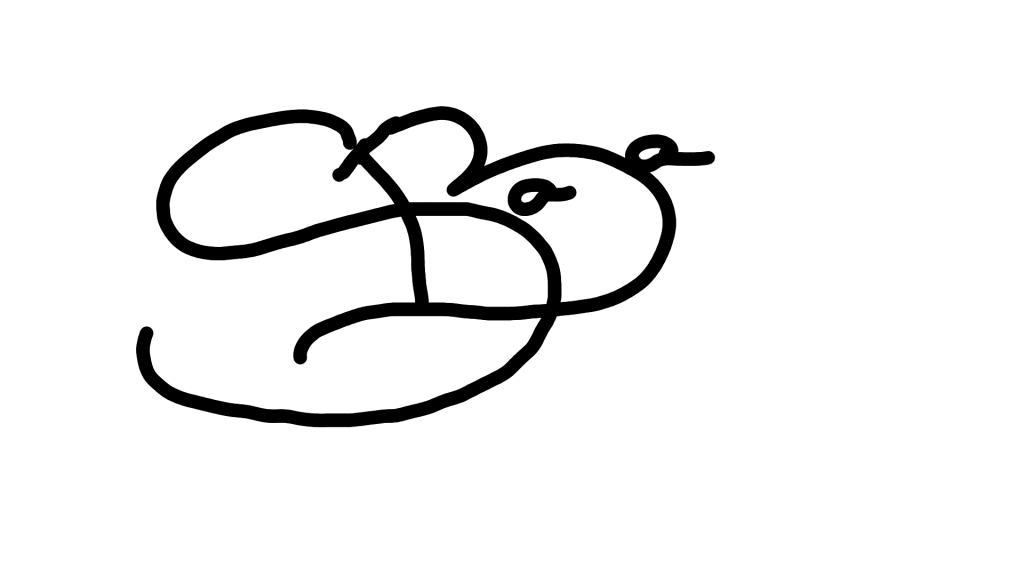
Wenn du noch weiter eintauchen möchtest:
„The Wisdom of Trauma“ (Film) / Dr. Gabor Maté
„Wenn der Körper Nein sagt. Wie verborgener Stress krank macht“ / Dr. Gabor Maté
„Schattenarbeit“ / Debbie Ford
„Owning Your Own Shadow: Understanding the Dark Side of the Psyche“ / Robert A. Johnson